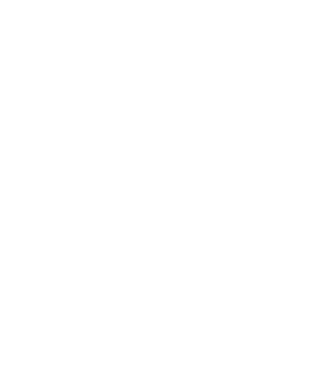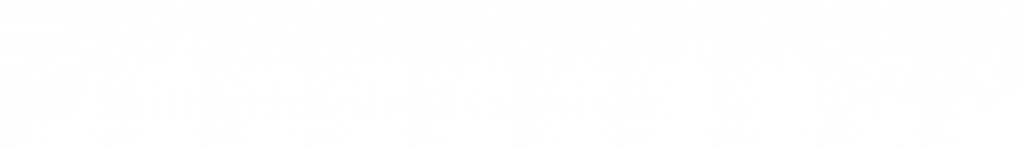Die Geschichten aus der Gastwelt
Georg W. Broich:
Vom Kochlehrling zum Catering-Champion
19. November 2024
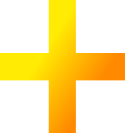
In Saint-Marie-de Campan beginnt die Quälerei. Ganz langsam, denn auf den ersten drei Kilometern hinauf zum Tourmalet steigt die Straße nur sanft an. Doch im weiteren Verlauf wird’s brutal. Bei La Mongie sind es zwölf Prozent, danach bis zur Passhöhe immer noch um die elf. Die Stunde der Kletterer schlägt. Wer da hoch will, braucht Waden wie Atommeiler – und natürlich das richtige Essen. Als Georg W. Broich genau deswegen als Tour-Caterer zum ersten Mal in einem Begleitfahrzeug des Teams Gerolsteiner saß, kam er aus dem Staunen nicht mehr heraus. Was Radprofis leisten, hat den Mann aus dem Rheinland seinerzeit unglaublich beeindruckt. Heute ist er ein glühender Radsportfan, der sich in der Szene auch als Sponsor einen guten Namen gemacht hat.
Der 59-Jährige, eigener Definition zufolge „Generation Didi Thurau“, schwingt sich aber nur selten in den Sattel seines Rennrads, ist Zeit für ihn wie für so viele Unternehmer eben auch Mangelware. Dabei sind es nicht nur die fünf Kinder von 16 Monaten bis 25 Jahren, die ihn auf Trab halten, sondern auch seine Broich Hospitality Group mit zwölf Firmen, 35 Millionen Jahresumsatz, 300 festen Mitarbeitern und rund 1000 Teilzeitkräften, eines der führenden Catering-Unternehmen in Deutschland.
Ein steiler Weg und Aufstieg zum Top-Caterer
Als Geschäftsmann hat Broich einen ähnlich steilen Aufstieg hinter sich gebracht wie die Tour-Fahrer auf Gipfelkurs, angetrieben von einer ausgeprägten Freude am Vorwärtskommen. Dabei ist auch ihm der Erfolg nicht in den Schoss gefallen. Broich hat über vier Jahrzehnte hinweg hart darauf hingearbeitet, um in seiner Branche das gelbe Trikot überstreifen zu können. „Ich wollte der erste System-Event-Caterer Europas werden“, sagt er. Das hat er geschafft. Wie, erzählt er häufig auf Tagungen und Kongressen, als Podcaster im Internet oder auch als gefragter Consultant.
Als er 1987 den elterlichen Partyservice übernahm, hätte er sich dergleichen nie träumen lassen. Gerade mal 21 Jahre alt stand er unvermittelt in der Verantwortung, nachdem sein Vater schwer am Herzen erkrankt war und deswegen nie mehr aktiv ins Geschäft zurückkehren sollte. Der junge Mann musste deswegen viel früher ran, als ihm lieb war. Mit 17 hatte Broich eine Kochlehre begonnen und in der Folge eigentlich die große weite Welt sehen wollen. Ihm winkten Stellen in Mailand, Paris oder Straßburg. Doch es wurde schneller als geplant Düsseldorf draus. „Dass ich die Firma übernehmen würde, war klar“, blickt er zurück. „Aber nicht damals schon.“
Doch der Macht des Faktischen widersetzt sich niemand. Hilfreich erschien ihm, dem jungen Georg, damals, dass die Broichs schon seit jeher Gastwelt-Unternehmer sind. Im 18. Jahrhundert betrieb die Familie einen Gasthof, und Großvater Carl gründete noch vor der Wende zum 20. Jahrhundert eine Metzgerei. Die schlechtesten Voraussetzungen waren das offensichtlich nicht. „Ich hatte zwar kein BWL-Studium, trug aber das Selbstständigen-Gen in mir“, lächelt Georg Broich, wenn er auf seine frühen Jahre zurückblickt. Jahre, in denen es viele Wochen gab, in denen er 80 bis 100 Stunden schuftete. Elend lange Arbeitstage und kurze Nächte mit vier oder fünf Stunden Schlaf. Allerdings nicht im weichen Federbett, sondern auf der harten Küchenbank, damit er am nächsten Morgen frühzeitig wieder loslegen konnte.
Dabei erreicht nicht jeder, der sich abstrampelt, auch den Gipfel. Wer da hin will, der muss vieles richtig machen. Wie Georg W. Broich, der alsbald erkannte, was er besonders gut kann – und was nicht. Denn die betriebswirtschaftlichen Aufgaben eines Unternehmers liegen dem kreativen Kopf nicht sonderlich. Deshalb wechselte er beizeiten den Steuerberater, um sich hier zu entlasten und voll auf das operative Geschäft konzentrieren zu können. Das war eine Maßnahme, die sich schnell auszuzahlen begann.
Erfolgsrezept Freundschaft und Fokus auf Stärken
Später holte er seinen Freund Burkhardt Schmitz als Finanzchef an Bord, um sich noch mehr auf seine persönlichen Stärken zu fokussieren, also auf die schöpferische Arbeit mit den Küchenchefs und auf das Marketing – „Burkhardt hat mich endgültig von den Fesseln der Kennzahlen befreit“, grinst Broich. Und freut sich, dass beide Freundschaften am Business nicht etwa zerbrochen, sondern noch enger geworden ist. Beide sind Patenonkel der Kinder des jeweils anderen, und Schmitz ist heute Gesellschafter der Broich-Gruppe, die nicht nur Essen an Kitas und Schulen liefert, sondern vor allem mit individuellen Food- und Eventkonzepten für jeden Anlass erfolgreich ist.
Mit Weitsicht haben die Freunde mittlerweile eine hervorragende zweite Reihe an Nachwuchsmanagern aufgebaut, die das Tagesgeschäft übernommen hat. Das Team harmoniert und eben auf dem Umstand, dass jeder zielgerichtet das erledigt, was er am besten kann, dürfte das gemeinsame Erfolgsrezept gründen, vermutet Georg W. Broich. „Gut kochen können viele“, sagt er. „Für viele gut kochen ist allerdings nicht so leicht.“ Das beherrschte er und seine Leute allerdings perfekt, wenn sie beim Bundesligaspiel in Mönchengladbach, beim Kongress in Bonn und bei weiteren Anlässen in Düsseldorf den Tisch decken – zeitgleich und in hoher Qualität, versteht sich.
Krisenfest: Rückschläge meistern und gestärkt zurückkommen
Die Fachpresse attestiert dem Top-Caterer Vorwärtsgewandtheit, aber auch Risikofreude. Mit einer klaren Linie und unterschiedlichen Standbeinen – sprich Locations und Konzepten – habe Broich sich in seinem Metier ganz vorne positioniert. So gut wie heute ist es freilich nicht immer gelaufen. Denn welches Leben ist ohne Tiefen? Als nahezu unverdaulicher Happen liegt Georg W. Broich der Nürburgring-Skandal von 2009 noch heute schwer im Magen. Der gigantische Finanzcrash der Betreibergesellschaft der Rennstrecke in der Eifel hat sein Unternehmen jede Menge Geld gekostet – eine Summe im dreistelligen Millionenbereich. Andere erholen sich von solchen Rückschlägen nicht mehr. Broich schon. „Georg, Kopf hoch! Wir sind Unternehmer. Keine Unterlasser,“ hat ihn der Vater eines seiner besten Freunde damals wieder aufgebaut. Ein US-Kollege hat es aus Sicht des Düsseldorfers sogar noch besser auf den Punkt gebracht: „George, we are hunters, not farmers.“ – „Wir sind Jäger, keine Bauern.“
Wer wird also aufgeben, nur weil er ein Etappenziel verfehlt hat? Nicht Georg W. Broich. Denn das Leben geht ja weiter, und es bietet so viele schöne Momente. Diese Einsicht gefällt ihm, trägt sie doch sein Geschäftsmodell: Wunderbare Augenblicke, die zu wunderschönen Erinnerungen werden, schaffen das, was man gemeinhin Lebensqualität nennt. „Solche Augenblicke zu kreieren ist unsere Aufgabe“, sagt er. „Als Caterer bieten wir Orte zum Abschalten und zum Genießen an. Beides können die Leute bei uns mit ihren Freunden tun, aber auch mit Fremden. Denn am Tisch kommt man leicht miteinander ins Gespräch.“
„Als Caterer bieten wir Orte zum Abschalten und zum Genießen an. Beides können die Leute bei uns mit ihren Freunden tun, aber auch mit Fremden. Denn am Tisch kommt man leicht miteinander ins Gespräch..“
Georg W. Broich
Genuss und Geselligkeit als Lebensphilosophie
Genuss verbinde, glaubt Broich und belegt diese Hypothese augenzwinkernd mit einem alten Foto, das seinen bierlaunigen Großvater anno dazumal beim Zechen im Hofbräuhaus zeigt. In nur drei Worten liefert er „die beste Definition des Begriffs Geselligkeit“ gleich hinterher: „Ich bin Rheinländer“.
Das Schwarzweiß-Bild spricht für sich, zeigt es doch beispielhaft, dass gesellige Menschen glückliche Menschen sind. Und Glücksmomente sind nun mal der Lohn aller Mühsal: Wenn nach harter Arbeit die schäumenden Biergläser aneinanderstoßen und wenn die Radprofis bei der Tour nach der Schinderei im Aufstieg wieder talabwärts sausen und ihnen der kühle Fahrtwind um die Nase weht. Oder wenn Georg W. Broich, was selten genug vorkommt, seinen Mercedes SL, Baujahr 1961, aus der Garage holt, um damit eine Spritztour zu machen, wenn die Sonne scheint. Für alte Autos kann er sich ebenso begeistern wie für den Radsport und seine Mission als Unternehmer, die darin besteht, seine Kreativität voll zu entfalten. Einer wie er fragt sich deswegen auch nie, ob die Flasche halb voll ist oder halb leer. Sondern nur, ob noch genügend Weinflaschen da sind …
Bildquelle: Julian Schmitz
Broich Catering
www.broich.catering.com
info@broichcatering.com
© DZG